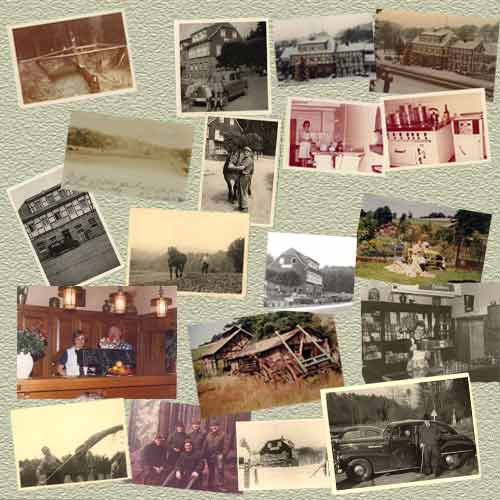 Wer
in Overath das Aggertal verlässt und die Straße L312 in Richtung
Much befährt, erreicht nach 6 Kilometern das Hotel und Speiserestaurant
„Fischermühle“ im oberen Naafbachtal. Wenn hier den
Besucher auch heute kaum mehr etwas an eine Mühle erinnert, so
liefert der Name des Hauses doch einen klaren Hinweis auf die Geschichte
des Anwesens. Wer
in Overath das Aggertal verlässt und die Straße L312 in Richtung
Much befährt, erreicht nach 6 Kilometern das Hotel und Speiserestaurant
„Fischermühle“ im oberen Naafbachtal. Wenn hier den
Besucher auch heute kaum mehr etwas an eine Mühle erinnert, so
liefert der Name des Hauses doch einen klaren Hinweis auf die Geschichte
des Anwesens.
Im Jahre 1783 baute Peter Fischer aus Krampenhöhe bei Marialinden
die Mühle an der Naaf bei Bommerich, die nach ihm „Fischermühle“
genannt worden ist. Im Jahre 1834 erbte sie sein Sohn Christian Fischer.
Gegen den Bau dieser Mühle hatte damals Graf von Schaesberg, Besitzer
des Rittergutes Großbernsau bei Overath Einspruch erhoben, konnte
sich aber nicht durchsetzen. Im Jahre 1797 waren im Kirchspiel Overath
nur fünf Mühlen, eine war die Fischermühle, alle anderen
Mühlen wurden später gebaut. Um
1850 wurden vom Naafbach, der auch heute noch ein Grenzgewässer
ist, er scheidet Rhein-Sieg-Kreis und Rheinisch-Bergischen-Kreis, 10
weitere Mühlen angetrieben. Die Naaf war ein fleißiger Bach,
sie mündet bei Kreuznaaf in die Agger.
Die „Fischermühle“ besaß einen Mahlgang und wurde
von einem oberschlächtigen Wasserrad angetrieben. Die Kraft ging
vom Wasserrad aus auf Wellbaum, Kammrad-Ritzel (Kegelräder), über
den Kammrad-Stirntrieb auf den Mühlstein. Gemahlen wurde Gerste,
Hafer und Roggen. Die Bauern brachten oft die Säcke mit Frucht
auf dem Rücken zur Mühle. Einen Sack Roggen, dessen Mehl der
Herstellung von Schwarzbrot diente, nannte man „Gebäckde“,
den Sack mit Gerste oder Hafer, Futter für Kühe oder Schweine,
bezeichnete man als „Saupongel“. Der Mahllohn, die so genannte
„Molter“ waren 6% des Malgutes und kam in die „Molterkiste“.
Bis 1920 war der „Fischermühle“ auch eine Knochenmühle,
300m unterhalb, angeschlossen (Dünger für Feld und Wiesen).
Das Wasser aus dem Untergraben konnte in den Knochenmühlengraben
abgeleitet werden und trieb die Knochenmühle an.
Früher hatten die „Lehnsherren“, hier Graf Schaesberg,
großen Landbesitz und eigene Mühlen, die oft “Zwangsmühlen“
waren. Die Bauern-Lehnsleute in der Umgebung hatten die Pflicht, ihr
Getreide dort mahlen zu lassen.
Die „Fischermühle“ (160m ü. NN) lag weit abseits
vom Verkehr. Durch das Naafbachtal führte nur ein schmaler Weg,
der mit Pferde- oder Ochsengespannen zur Holz- und Heuabfuhr diente.
Im Jahre 1894 gelangte die „Fischermühle“ in den Besitz
der Familie Hollinder.
 Der Fuhrunternehmer Peter Hollinder, geboren
1860 in Vilkerath, kaufte damals den Betrieb samt Landwirtschaft, Mühle,
Kolonialwarengeschäft und Fuhrbetrieb. Das Fuhrgeschäft für
Blei- und Zinkerz Transporte der Erzgruben Nikolaus und Phönix
zur Eisenbahn nach Overath war der Haupterwerb. Früher war ein
breiter gut befestigter Fahrweg von Much über Bövingen, den
Höhenrücken Der Fuhrunternehmer Peter Hollinder, geboren
1860 in Vilkerath, kaufte damals den Betrieb samt Landwirtschaft, Mühle,
Kolonialwarengeschäft und Fuhrbetrieb. Das Fuhrgeschäft für
Blei- und Zinkerz Transporte der Erzgruben Nikolaus und Phönix
zur Eisenbahn nach Overath war der Haupterwerb. Früher war ein
breiter gut befestigter Fahrweg von Much über Bövingen, den
Höhenrücken Ühling (die Sage: Kuhhirt o Kuhhirt treib
heim, der Ühling der Ühling bricht ein), „Fischermühle“,
Lorkenhöhe, Landwehr, Marialinden nach Overath die Hauptverbindung
an den Verkehr. Das Erz wurde über den vorgenannten Weg zwei-,
vier- oder auch sechsspännig mit starken Pferdewagen über
die Höhe bei Landwehr Ühling (die Sage: Kuhhirt o Kuhhirt treib
heim, der Ühling der Ühling bricht ein), „Fischermühle“,
Lorkenhöhe, Landwehr, Marialinden nach Overath die Hauptverbindung
an den Verkehr. Das Erz wurde über den vorgenannten Weg zwei-,
vier- oder auch sechsspännig mit starken Pferdewagen über
die Höhe bei Landwehr
 und weiter zur Bahnstation nach Overath gefahren.
Auf dem Rückweg wurden Maschinenteile, Gebrauchsgüter und
immer wieder Kohle für die Grube „Nikolaus-Phönix“
transportiert. Die Grube beschäftigte während ihrer Blütezeit
mehr als 180 Bergleute. Diese arbeiteten bis in eine Tiefe von 270 Metern. und weiter zur Bahnstation nach Overath gefahren.
Auf dem Rückweg wurden Maschinenteile, Gebrauchsgüter und
immer wieder Kohle für die Grube „Nikolaus-Phönix“
transportiert. Die Grube beschäftigte während ihrer Blütezeit
mehr als 180 Bergleute. Diese arbeiteten bis in eine Tiefe von 270 Metern.
Im Jahre 1911 wurde die Erzförderung wegen zu geringer Ausbeute
eingestellt, der Bergbau bei der „Fischermühle“ ist
seither nur noch Geschichte.
In der näheren Umgebung, Overath, Much, Neunkirchen wird von vielen
kleineren Erzgruben berichtet, über den Beginn des Erzbautätigkeit
gibt es keine genauen Angaben, es wurden schon Werkzeuge aus der Römerzeit
gefunden.
Früher war jeder abgelegene Bauernhof, so auch die „Fischermühle“,
ein Selbstversorgungskreis, in dem alles erzeugt wurde, was Bauer und
Betrieb benötigten. Die Handwerker, Stellmacher, Schreiner, Schmied,
Sattler, Schuster, Näherin kamen ins Haus und führten die
erforderlichen Reparaturarbeiten aus.
Die „Fischermühle“ ist eingebettet in eine liebliche
Gegend. Einen besonders schönen Rundblick über unsere Heimat
hat man vom nahe gelegenen Ort Hevinghausen am Beerenwäldchen,
eine Anhöhe von 269 Meter. Es ist „Unser Heimatblick“.
Der Wanderer erblickt Marialinden mit den beiden Türmen der gotischen
Kirche, die Silhouette der Schloss-Stadt Bensberg, das 25 km entfernte
Siebengebirge und den „Heckeberg“, mit 384 Metern die höchste
Erhebung der angrenzenden Gemeinde Much. Wendet man sich nach Osten,
so schweift der Blick über das Bröltal, die Nutscheidhöhen
und weiter über das Siegtal bis hin zum Westerwald. Nicht weit
von der „Fischermühle“ liegt bei Eckhausen der „Hohnsberg“
(301 Meter).
Um diesen kleinen Berg rankt sich eine wahre Geschichte von lokaler
Bedeutung. Hier fand am 18. November 1795, als Napoleon und seine Soldaten
Köln und auch Teile des Bergischen Landes kontrollierten und plünderten,
gegen die sich die Bevölkerung auflehnte, unter Führung von
Vikar Ommerborn, mit Getreuen aus der Agger-, Bröl- und Sülztalgegend
die „Schlacht am Hohnsberg“ statt. Vikar Johann Peter Ommerborn
zu Offermannsheide (geboren in Ommerborn) „Der Held von Ommerborn
und Beschützer unserer Heimat“. Gottes Hand über unser
geliebtes Bergisches Land.
Im Mai 1999, auf der Geburtstagsfeier einer Verwandten, die 90 Jahre
wurde, haben wir von alten Zeiten geschwärmt. Sie war als Kind
und junges Mädchen ab 1914 immer wieder mehrere Wochen in Ferien
hier, sie soll noch mal zu Wort kommen:
„Ja“, sagt sie „ich habe noch im alten Backhaus gesessen
als Brot gebacken wurde, habe geholfen den Ofen mit Brennholz zu beschicken,
habe am Bach gespielt der noch direkt am Hause vorbei floss, jeder achtete
darauf, und auch ich bin gelaufen und habe gerufen ’Onkel Peter
die Mühle, die Mühle’, wenn das Räderwerk laut
ging, das Getreide alle war und das Haus leicht erzitterte, habe oft
in die Kammer des Wasserrades geschaut wenn das Rad lief, habe die Knochenmühle
noch gekannt, habe zugesehen wenn der Mühlengraben gesäubert
wurde, habe noch das Mühlenzimmer des Müllers Höhner
gekannt (er war „Müller und Beck“), bin oft spät
Abends mit Tante K. zur Kluse gegangen und haben geholfen das Schütz
zu öffnen, habe mit Tante W. noch die Maiandachten im alten Kreuz
erlebt, habe die alten Pferdeställe noch gekannt, habe zugesehen
wenn die Mühlsteine geklopft-geschärft wurden, habe den kleinen
Laden für Kolonialwaren mit seinen Regalen und all den kleinen
Schublädchen noch genau in Erinnerung und es war immer ein kleines
Erlebnis, wenn am Sonntag mit dem Kutschenwagen zur Kirche gefahren
wurde. Es hat sich seit dem sehr viel geändert.“ Und etwas
Wehmut lag in ihrer Stimme als sie sagte, „Es ist alles so anders
geworden.“
Der Strom, die Elektrizität kam 1908 ins Naaftal. Die Straße
Overath-Much wurde
 1925-1927 gebaut und die „Fischermühle“
hatte den Zugang zur weiten Welt erlangt. 1925-1927 gebaut und die „Fischermühle“
hatte den Zugang zur weiten Welt erlangt.
Das Restaurant „Fischermühle“ wurde 1928 von Peter
Hollinder jun. (1886-1976) gebaut.
Bis 2001 betrieb Rudi Hollinder die umgebaute und modernisierte „Fischermühle“
als Hotel und Speiserestaurant. 1988 stieg Stefan Hollinder mit ein
und übernahm 2001 die Geschäftsführung der „Fischermühle“.
Er ist nun Geschäftsführer, Küchenchef und Ausbilder
zugleich.
Die Menschen von heute lieben das moderne Leben, doch die Natur rund
um die „Fischermühle“ ist geblieben, hat sich nicht
verändert.
Die Technik hat auch hier in unserem einst so stillen Tal Einzug gehalten
und wenn man bei offenem Fenster übernachtet, hört man morgens
einzelne Autos die vorbeifahren, aber dann kehrt die Stille wieder ein
und man hört den Naafbach, und der rauscht und singt sein Lied
wie vor 100 Jahren.
Die
Familie Rudi und Stefan Hollinder versucht, die Tradition weiterzuführen
und wünscht ihren Gästen einen erholsamen Aufenthalt.

|